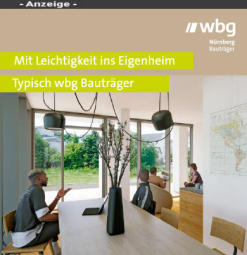#Lesbische Geschichte
Rechtlos lesbisch
Rund 40 Personen kamen am dritten September-Donnerstag zum interessanten Vortrag mit anschließender reger Diskussion zum Thema „Verfolgung und Diskriminierung der weiblichen Homosexualität“ ins Restaurant Literaturhaus (Luitpoldstr. 6). Organisiert von Fliederlich e.V. in Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung. Historikerin Dr. Kirsten Plötz räumte gleich zu Beginn mit einem geschichtlichen Missverständnis auf. Der Paragraph 175 galt nie für Frauen. Er wurde in der Zeit der Nationalsozialisten nie auf die Frauen ausgeweitet. Nach der Aktenlage sind gerade einmal 100 Frauen nach dem §175 verurteilt worden. „Allerdings vermutlich, weil sie schwule Männer unterstützt hatten“, betont Dr. Kirsten Plötz. In den 50er Jahren wollte der Volkswartbund den Paragraphen auf Frauen erweitern: ‚eine Straflosigkeit ist inkonsequent‘. Eine rechtliche Debatte in der Bundesrepublik in den 60er Jahren erfolgte durch die demokratische Bewegung im Land: ‚für Homosexuelle ist das dritte Reich noch nicht zu Ende‘. 1969(!) fällt dadurch die NS-Fassung des §175 weg. Damit war auch die gleichgeschlechtliche Liebe für Männer ab 21 Jahren nicht mehr strafbar. Die Lesbenbewegung begann in den 70er Jahren durch die mediale Zeitungsberichterstattung über einen Mord in Norddeutschland. „Mord auf Bestellung“ waren die Schlagzeilen. Dass die Frauen in Notwehr gehandelt hatten, wurde verschwiegen. Der Ehemann hatte seine Frau bedroht, sie umzubringen, er hatte sie mehrfach vergewaltigt und verweigerte die Scheidung. Seine Frau wollte aber mit der Freundin zusammenleben. Die Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar! Oft wird allgemein die gesellschaftliche Stellung der Frau vergessen. Frauen sollten sich dem Mann unterordnen. Deshalb waren viele Lesben verheiratet. Oft aus finanziellen Gründen. Schon 1904 wurde über die Rolle der Frau im Bürgerlichen Gesetzbuch zitiert: „Rechtlosigkeit, Willkür und sklavische Unterwerfung“.
Goldene zwanziger Jahre
Während der Weimarer Zeit ab 1918 gab es eine kurze Phase der Freiheit, mit Damenclubs in Berlin oder Zeitungen wie „Die Freundin“ mit einer bundesweiten wöchentlichen Auflage von 10.000 Stück! Die heutige L-Mag schafft die Zahl nicht einmal im Monat. Doch ab 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten endete auch diese Hoffnung. Ein großes Problem stellte die Einsamkeit in der Provinz dar. Die Möglichkeit, eine passende Lebensgefährtin zu finden, bestand nur über Zeitungsanzeigen u.a. mit Postlageradressen. Allerdings musste man in bestimmte Code-Wörter eingeweiht sein, Umschreibungen zum eigenen Schutz verwenden. In der Nazi-Zeit fand keine systematische Verfolgung von Lesben statt. Deren Beziehungen waren gewissermaßen nachrangig wie die allgemeine rechtliche Stellung der Frauen und im Wesentlichen abhängig von der Laune der Männer. Vorrangig blieben die Verfügbarkeit für den Herrn des Hauses und das Gebären von Nachwuchs.
‚Schwule Frauen‘
Generell ist die lesbische Geschichte, außer in einzelnen Fragmenten, zum größten Teil unerforscht, für die Universitäten einfach nicht relevant genug. Nur in einzelnen Bundesländern wie Rheinland Pfalz und Hessen wurde gezielt recherchiert. In der Nachkriegszeit folgte als Antwort auf den Nationalsozialismus ein katholisches Sittengesetz. Sex sollte es nur in der Ehe geben, für die Kinderzeugung. Gesellschaftlich war es für Frauen nahezu undenkbar, nicht zu heiraten und keine Kinder zu kriegen. Das Thema Lesben wurde generell verschwiegen. Während es für männliche Homosexualität zahlreiche Einträge im damaligen Brockhaus gab, fand man wenige Einträge für Frauen. Generell meinte man bei Homosexualität die schwulen Männer. Die Behörden handelten beim Urteil im Ehe- und Familienrecht gegen die Mütter. Sowie eine lesbische Beziehung im Spiel war, folgte regelmäßig die Wegnahme der Kinder. Erst 1984 gab es das erste positive Urteil für das „gleichgeschlechtliche Elternteil“. Öffentliche Bilder lesbischer Paare in Tageszeitungen und Zeitschriften gab es nur wenige. Wenn, dann wurden diese entweder als Touristinnen oder Kolleginnen untertitelt. Die Emanzipationsanfänge der Frauen waren gleichzeitig die Entstehung der Lesbenbewegung. Es war kompliziert, die ersten haben sich als ‚schwule‘ Frauen bezeichnet. Viele kamen mit der Subkultur nie in Kontakt. Frauenhäuser und Selbstverteidigungsgruppen entstanden. Oft lebten Kämpferinnen in heimlichen lesbischen Beziehungen. Dabei waren es fast ausschließlich Lesben, denen das offene Interesse und der Wunsch die gesellschaftliche Situation der Frauen zu ändern, zu verdanken ist. Viele Emanzipations-Aktivistinnen hatten erst nach jahrzehntelangem Einsatz ihr öffentliches Coming-out.
Text/ Foto: Norbert Kiesewetter
GAYCON September 2020